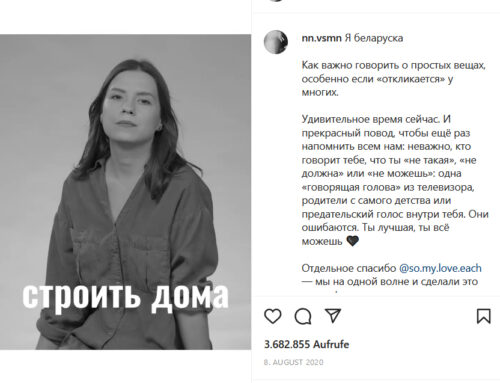Greenpeace-Aktivisten versuchen, die Verklappung nuklearer Abfälle im atlantischen Ozean zu verhindern – und stoßen auf Gegenwehr und Hohn. Erst Jahre später hat die Aktion Erfolg.
Dutzende Fässer voller Nuklearabfall an Bord, rückt der von der britischen Atombehörde (UKAEA) gecharterte Frachter Gem im Sommer 1979 Richtung Atlantik aus. Entsorgt werden soll die hochgiftige radioaktive Fracht wie jedes Jahr etwa eintausend Kilometer südwestlich der englischen Küste. Die Besatzung des Frachters bleibt jedoch nicht lange unbehelligt: Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace heften sich am Steuer ihres neuen Flaggschiffs Rainbow Warrior an ihre Fersen. Um das Abwerfen weiterer Fässer zu verhindern, versuchen sie sich mit Schlauchbooten unter der Laderampe der Gem zu positionieren.
Die Crew des Frachtschiffs geht zur Gegenwehr über. Sie setzt Wasserwerfer ein, um die Greenpeace-Mitglieder zu vertreiben, und fährt währenddessen mit der Verklappung fort. Immer wieder rollen die schwarzen Fässer von der Frachter-Rampe hinunter und verfehlen die Schlauchboote nur um Haaresbreite. Es kommt zum Schlagabtausch zwischen den Aktivisten und der Besatzung: „Last night we saw thirty fishing boats”, ruft eine Frau erregt. „You’re meant to be dumping outside the fishing area, aren’t you?” – “Not a problem!“, kontert die Besatzung, „No big deal!“. Seinerzeit im Auftrag von Greenpeace mitgefilmt, wurde ein Zusammenschnitt der Szenen im Jahr 2015 auf dem YouTube-Kanal „AP Archive“, einem Videoarchiv der Nachrichtenagentur Associated Press, veröffentlicht.
Zu den Hintergründen: Ab den späten 1940er Jahren veranlassten die Energiebehörden verschiedener Industriestaaten, dass Nuklearabfälle – entstanden etwa durch die Produktion von Atomwaffen oder den Betrieb von Kernkraftwerken – auf dem Meeresgrund zu deponieren seien. Da es seinerzeit als gesichert galt, dass radioaktive Substanzen und andere Industrieabfälle durch die Meeresströmung bis zur Unbedenklichkeit verdünnt würden, ging nahezu jedes Land, das derartigen Müll produzierte, auf ähnliche Weise vor. Anfang 1972 wurde dann erstmals mit der Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping from Ships and Aircraft (kurz: Oslo Convention) ein Abkommen gegen die Verschmutzung der Meere unterzeichnet. Zwei Jahre später trat es in Kraft und galt für den Atlantik, den Arktischen Ozean, das Mittelmeer und die Ostsee. Die bedeutendsten Atomindustrie-Staaten unterzeichneten das Abkommen allerdings nicht.
Ebenfalls im Jahr 1972 wurde im Zuge der London Covention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (kurz: London Convention) vereinbart, dass Müll, der für das Ökosystem eine konkrete Bedrohung darstellt, nicht im Ozean entsorgt werden darf. Zwei Jahre, nachdem die London Convention im Jahr 1975 rechtskräftig geworden war, hatten sie insgesamt 40 Staaten unterzeichnet – darunter mit den USA, der UdSSR und Großbritannien einige der größten Produzenten von Nuklearabfällen. Der Haken: Die Atomlobby hatte durchsetzen können, dass sogenannter „schwach strahlender Abfall“ nicht von den Vereinbarungen betroffen war. Die Kategorisierung in „low-“, „medium-“ und „high-level radioactive waste“ war von der International Atomic Energy Agency (IAEA) vorgenommen worden, einer UN-Organisation, die von Kritikern als Arm der „Nuclear Lobby“ bezeichnet wird. So wurden später Elemente mit hoher Radiotoxizität und langer Halbwertszeit – etwa Plutonium und Strontium – in als „harmlos“ deklariertem Müll gefunden.
Greenpeace wurde schnell auf die Umweltgefahr der Verklappung aufmerksam. Bereits 1978 deckte die Besatzung der Rainbow Warrior, begleitet von einem Kamerateam aus London, die Aktivitäten des britischen Frachters Gem auf. Die Umweltaktivisten nahmen zunächst lediglich eine Beobachter-Rolle ein: Sie dokumentierten, ohne zu intervenieren, und zeigten das aufgenommene Filmmaterial auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Da die Gem jährlich zur selben Zeit Kurs Richtung Atlantik nahm, konnten die Aktivisten um David McTaggart – der erste Vorsitzende des Dachverbandes Greenpeace International mit Sitz in Amsterdam – ihre Aktion für den darauffolgenden Sommer detailgenau planen.
Wiederholt organisierte Greenpeace Proteste mit Schlauchbooten, während sich der Einsatzbereich der Organisation zugleich auf den Pazifik und die Nordsee ausweitete. Von Beginn an setzten die Umweltschützer darauf, sofern möglich bei jeder Protestaktion ein Kamerateam zur Dokumentation mitzuführen – einerseits zur medialen Verbreitung, andererseits als Beweismaterial für den Fall sich anschließender gerichtlicher Auseinandersetzungen. Zudem stellt Greenpeace seit Ende der 1970er Jahre regelmäßig aus dem Rohmaterial einen „Clipreel“ zusammen, der Medienanstalten und Nachrichtenagenturen zugänglich gemacht wird.
Ob es sich bei dem Video um einen Original-Clipreel von Greenpeace oder um eine bearbeitete Fassung der Associated Press handelt, ist unklar. Die Qualität der Aufnahmen leidet in weiten Teilen unter den widrigen Bedingungen des offenen Ozeans: Fast alle Einstellungen sind aus einem Schlauchboot heraus gefilmt, das vom Seegang und der Bugwelle des Frachters auf- und abgeschleudert wird; zudem gehen die Rufe der Aktivisten im Lärm der Schiffsmotoren und Wasserwerfer unter. Um eine möglichst effiziente Distribution zu gewährleisten, setzte Greenpeace bei der Aufzeichnung auf das Format Beta-SP. Da die entsprechenden Kameras, die noch bis in 90er Jahre Verwendung fanden, zwischen zehn und 15 Kilogramm wogen und das Filmen somit eine körperlich anspruchsvolle Aufgabe darstellte, wurde eigens ein Kameramann der Nachrichtenagentur United Press International Television News (UPITN) engagiert. Heute liegen die Bildrechte bei AP, nachdem UPITN 1998 aufgekauft wurde.
Die einzelnen Bestandteile des Videos wirken beinahe willkürlich aneinandergefügt: Es ist kein nachvollziehbarer chronologischer Ablauf der Geschehnisse erkennbar. Hintergrundinformationen werden nicht geliefert, stattdessen soll das Video als Augenzeugendokument dienen und setzt dazu auf höchstmögliche Authentizität. Dennoch lässt sich eine gewisse Spannungskurve, eine dramatische Zuspitzung hin zum Ende ausmachen: Zu Beginn wird die Rainbow Warrior als ebenbürtige Gegnerin der Gem inszeniert, sie prescht durch die Wellen und sagt dem Frachter den Kampf an. Dann jedoch, während die Aktivisten von den Wasserwerfern abgewehrt werden, filmt die Kamera von unten zum Frachter herauf – es soll der Eindruck eines klassischen Kampfes von „David gegen Goliath“ entstehen. Auf die Frage, warum sie denn Nuklearabfälle in Fischerei-Gewässern entsorgen würden, reagiert die Besatzung der Gem mit Spott und Hohn. Spätestens hier wirkt sie nun wie ein übermächtiger Gegner.
Im abschließenden Interview legitimiert der Greenpeace-Vorsitzende David McTaggart, der ebenfalls vor Ort ist, die Aktion als moralisch geboten: „These are international waters. We have the right to be here by common heritage”, bekundet er und deutet den Protest somit als gerechtes Aufbegehren: „International waters belong to everybody, to all of us. The question is, what right do they have to be here?” Hinter ihm prangt ein Banner mit der Aufschrift „Nuclear power? No thanks!“ – das Motto der damals aufkeimenden Anti-Atomkraft-Bewegung.
Die 1979 von Greenpeace begonnene Protestwelle gegen die Verklappung von Nuklearabfällen hatte weltweit eine Sensibilisierung für die Verschmutzung der Meere zur Folge. Greenpeace setzte dabei nicht nur auf Bewegtbilder: Unmittelbar neben dem Kameramann von UPITN saß der niederländische Fotograf Floris Bergkamp im Schlauchboot, der das Geschehen aus derselben Perspektive in Schwarzweißbildern dokumentierte. So konnte das Material gleichermaßen an TV- und Printmedien verbreitet werden. Bergkamps Einsatz wurde 1980 von World Press Photo mit der Verleihung des ersten Oskar Barnack Award gewürdigt – einer Auszeichnungen für Fotografinnen und Fotografen, die mit einer kurzen, in sich geschlossenen Bilderstrecke die Beziehung von Mensch und Umwelt auf besondere Weise darstellen. Die geschickte mediale Inszenierung der Greenpeace-Aktionen trug mutmaßlich dazu bei, dass 1993 eine Verschärfung der London Convention beschlossen wurde – ein vollständiges Verbot der Entsorgung nuklearer Abfälle im Meer war die Folge.
Heute steht vor allem die Frage im Raum, was seitdem mit den abgeworfenen Fässern geschehen ist. Die Verklappung wurde gestoppt, doch Informationen zu den Abwurfstellen, der Art der Nuklearabfälle und deren Strahlungsgrad sind nach wie vor lückenhaft – bis in die 1970er Jahre herrschte keine Dokumentationspflicht. Vor einigen Jahren zogen Greenpeace-Mitglieder im Rahmen eines Forschungsprojekts marode Fässer mit austretendem radioaktiven Material an Bord ihres Schiffes. Letztendlich mussten aber auch sie die teils stark beschädigten Fässer zurück in den Ozean werfen, da sie über keine angemessenen Entsorgungsmöglichkeiten verfügten. Eine umfassende Bergung ist bis heute nicht angedacht.
Alexander Campos da Ponte